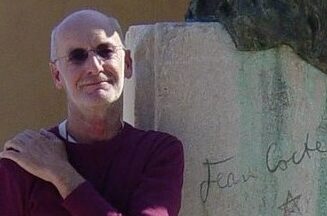Von Albert Wittwer
Wir sind so frei. Ist uns die Konsumfreiheit so wichtig?
In einer Publikums-Teilnahmesendung von Radio Vorarlberg sprachen sich drei Viertel der fast ausschließlich männlichen Anrufer gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von hundert Kilometern pro Stunde auf Autobahnen aus. Unbeirrt von den Darlegungen der Experten, wonach dadurch der Treibstoffverbrauch um fünfundzwanzig Prozent sinken würde. Mit entsprechenden Einsparungen beim Ausstoß von CO2 und in der Geldbörse. Unbeirrt vom Umstand, daß auf der Strecke Bregenz – Wien der theoretische Zeitverlust nur etwa vierzig Minuten beträgt. Oder daß der langsame Verkehr flüssiger ist und zu weniger Staus führt, was in elektronisch geregelten Abschnitten zwischen etwa Passau und Memmingen oder Chiasso – Bellinzona viele von uns schon erlebt haben.
Es geht den Anrufern um die Freiheit. Ähnlich sehen es wohl die 46 Prozent der Österreicher, die nach einer Umfrage des Market-Institutes die Sanktionen gegen Rußland aufheben wollen. Die Ukraine, die USA, die Nato und die EU seien am Angriffskrieg mitschuldig. Daher sollte Österreich „besondere Handelsbeziehungen“ mit Rußland aufnehmen, um wieder mehr Gas geliefert zu erhalten.
Wenn wir sparen müssen, beim Autofahren, beim Energieverbrauch wird unsere Freiheit eingeschränkt. Welche Freiheit?
Ähnlich wie beim langsameren Autofahren darf die Frage nach der Wirksamkeit auch bei Sanktionen gestellt werden. Die Sanktionen erscheinen uns ja inzwischen als Hauptursache aller Unbequemlichkeiten, des lästigen Energiesparens und vor allem der durch die Verknappung fossiler Energieträger ausgelösten Teuerungen. Daß es zugleich umweltfreundlich ist, weniger fossile Energie zu verbrauchen, scheint vergessen worden zu sein.
Die Frage der Wirksamkeit von Einfuhrbeschränkungen für Öl und Waren aus Russland und von Lieferbeschränkungen für Spitzentechnologie dorthin läßt sich nicht klar beantworten. Sicher ist, daß die russische Bevölkerung darunter mehr leidet, als etwa die Bürger der EU. Die Reisebeschränkungen für die russischen Bonzen sind zwar lästig. Das Einfrieren von Vermögen der Oligarchen zeigt, wegen der Schachtelkonstruktionen und der weltweit mangelnden Zusammenarbeit von Finanz- und Strafbehörden, wenn es um viel Geld geht, wenig Wirkung.
Bei Fortsetzung des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges ohne Verhandlungen mit territorialen Zugeständnissen werden auf mittlere Sicht beide Seiten ihre Ziele klar verfehlen. Die Militäroperation der russischen Diktatur ist ein Fiasko, erreicht die hoch gesteckten Ziele des heiligen Russland keinesfalls. Aber ein Systemwechsel in Russland, auf den man hoffen konnte, ist nicht in Sicht. Und die grauenhafte Vorstellung jahrelanger Kriegsgräuel in Europa, vor unserer Haustüre, wird von der politischen Führung im Westen sorgfältig ausgeblendet.
Daß Österreich sich solidarisch innerhalb und mit der EU positioniert, ist alternativlos. Sogar die Schweiz tut nichts anderes.
Dennoch: Die großen Staatenlenker dilettieren. Es sind Dinosaurier, die sich nur alles oder nichts, eine bessere Welt der Kompromisse nicht vorstellen können. Als wären sie elektronische Rechner denken sie nur in Weiß-Schwarz, Ja-Nein, Plus-Minus. Eine Pseudogenauigkeit, die uns die Anhänger der immerwährenden Digitalisierung vorgaukeln und die sie nachbeten. Sie müssen auch nichts mehr dazulernen. Gut, etwas anderes läßt sich auch im politisch-extremeren Populismus nicht verkaufen.
Dabei ist die Welt vor allem ambivalent und es sind die Entscheidungsgrundlangen zufolge ihrer immensen Komplexität immer mangelhaft. Derweil werden die wichtigen Aufgaben bei Menschenrechten, Armut, Biosphäre und Klima aufgeschoben. Den Enkeln aufgebürdet. Vielleicht könnte uns auch deren Freiheit, etwa kühlere Luft zu atmen und sauberes Wasser zu trinken, interessieren. In Österreich und noch mehr Deutschland traut sich die politische Kaste nicht einmal, ein Tempolimit auf Straßen, das allen nützen und Putin schaden würde, einzuführen.
Sind wir wirklich in die Falle der „Ästhetisierung des Konsums“ geraten, hängen unser Herz an die früher unvorstellbare Differenzierung von Kleidung bis zu Automobilen, von Kosmetik bis zum Streaming, von industriell hergestellten Fertigsuppen? „Denn wo unser Herz ist, da ist unser Schatz“*).
Anmerkungen:
Adorno, Ästhetisierung des Kapitalismus
Rupert Riedel über das Lernen in „Kein Ende der Genesis“, ähnlich Szasz in Heresies.
Rebecca Reinhard in „Die verbödete Vernunft“ und Lisa Herzog, Ambiguitätstoleranz.
*) Matthäus 6/21