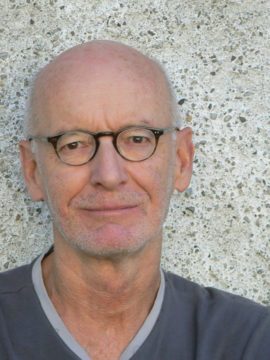Von Dr. Albert Wittwer
Gefahr für die Demokratie.
Ich möchte Sie nicht mit den Statistiken langweilen, ob eine Handvoll von Einzelpersonen die Hälfte des gesamten weltweiten, geldwerten Vermögens besitzen. Wie dröge ist die Diskussion, ob diese Statistiken – immerhin von durchaus renommierten Quellen – fehlerhaft sind. Fehler in dem Sinne, daß es auch zehn Prozent mehr oder weniger sein können.
Es ist auch nicht beeindruckend, daß sie sich als Tugendidole inszenieren. Sie verfügen und bestimmen über ihre Spenden und Stiftungen autonom. Die Spenden verringern oft ihre Steuerlast beträchtlich. Sie inszenieren sich als Innovatoren, als geniale Erfinder und Unternehmer, manchmal sogar als soziale Aufsteiger. Sie verzeihen die männliche Form, es fallen mir gerade keine Frauen aus der einsamsten Elite der Oligarchen ein. In Wahrheit wissen wir nichts von ihnen, außer dem, was sie – als Inszenierung – freiwillig preisgeben.
Keine Angst, es geht in diesem Text nicht um die Fragen, ob sie den Reichtum an uns Konsumenten redlich verdient haben, ob sie Steuern hinterziehen, ihre Zentralen als Briefkästen in Steuerparadiesen verstecken. Auch nicht um die Lüge vom Trickle-Down, daß vom Luxuskonsum der Superreichen alle profitieren, weil sie so viele Arbeitsplätze auf Jachten, in ihren Chalets und Penthäusern bereitstellen. Oder daß die Mehrung des Vermögens der Reichsten zugleich den Wohlstand der Ärmeren vermehre, wie das steigende Wasser bei Flut die kleinen wie die großen Schiffe anhebt.
Nein, was sie gefährlich macht, ist ihr dominanter Einfluß in der Demokratie. John Rawls hat schon vor Jahrzehnten beschrieben, daß die Menschen in Bezug auf ihre politischen, staatsbürgerlichen Rechte gleich sein sollen. Also daß Differenzierungen wie früher nach Geschlecht oder ethnischer Zugehörigkeit – aber auch nach Bildung und Vermögen bzw. Einkommen – obsolet sind. Sie bergen die Gefahr des Entstehens von Oligarchie. Oder, kaum besser, der autoritären, der gelenkten Demokratie. Wenn man mindestens vielfacher Millionär sein muß, um für ein hohes politisches Amt anzutreten ist die Sache transparent. Wenn man – wie in großen Teilen der Welt – die Unterstützung von Millionären benötigt, sollten die Alarmglocken klingeln.
Den Milliardären gehören die elektronischen, internetbasierten Medien. Den Milliardären gehören bedeutende Zeitungen und TV-Sender. Wer glaubt, daß sie sich aus der Linie ihrer Medien heraushalten, möge weiter träumen, daß sich ökonomie-darwinistisch alles zum Besten wendet. Soeben hat der Fiat-Erbe John Elkan, Eigentümer des Economist, eine der beiden bedeutenden italienischen Tageszeitungen, La Repubblica, vorher dezidiert unabhängig, übernommen, der Chefredakteur wurde entlassen. Besonders originell war die lange aufrechterhaltene Behauptung von Google, das Management habe keinen Einfluß auf den Such-Algorithmus. Die Europäische Union hat damit aufgeräumt.
Was uns aktuell bedroht, ist die Intransparenz der Parteienfinanzierung. Noch besser wäre eine Obergrenze für Zuwendungen an Parteien. All das sollte für Rechnungshof und Gerichte einsehbar sein, was in Österreich nicht der Fall ist.
Darüber hinaus sind die Möglichkeiten der Milliardäre, die „Stimmung für sie günstig zu beeinflussen“ immens. Ein bedeutender Österreichischer Unternehmer hat dutzende große, steuerfreie Schenkungen, zwischen € 200.000 und Millionenbeträgen an Personen getätigt, mit denen er nicht verwandt ist. Die Superreichen finanzieren Think-Tanks, Forschungsinstitute. Möglicherweise ist George Soros, von Ungarn hinausgeschmissen, „ein Guter“, aber er hat eine Agenda.
„Mit dem Leben in Freiheit, in einer liberalen Demokratie, müssen wir verantwortungsvoll umgehen.“ Wie können wir uns wehren? Die Medien, europäische Qualitätszeitungen, kritisch lesen. Den öffentlichen Rundfunkt unterstützen. In Korruptionsfällen nicht den Schluß ziehen, alle wären gleich. Das trifft nicht zu. Die Bekämpfung von Korruption als das Fieber betrachten, das die Viren entsorgt.
Bei Wahlen nicht den Unterhaltungswert, das schauspielerische Talent der Kandidaten bewerten. Wir sollten feststellen, ob die Wahlwerber für hohe Ämter autonom für etwas stehen, ein ethisches Fundament haben. Oder ob sie als trojanisches Pferd oligarchischen Interessen dienen.
Zitate: Schlagzeile frei nach WOZ Nr 19/2020 über Martin Schürz: Überreichtum, Campus Verlag 2019; John Rawls: Theory of Justice; OECD; Der Standard u.a.:Schenkungsliste Novomatic; BP Alexander VdBellen.